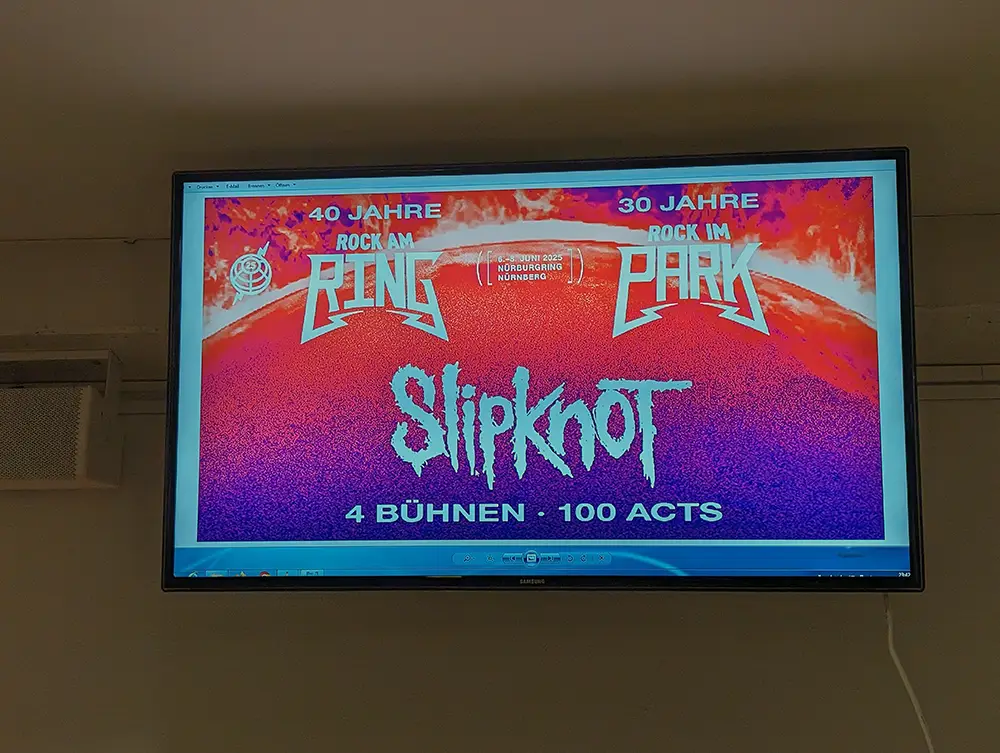Schlamm, Sonne und gute Musik sind die Bilanz eines Tagesbesuchs auf dem diesjährigen Dockville. Da sind am Ende auch die Organisationsschwierigkeiten verkraftbar.

Das Dockville ist ein noch junges und ungewöhnliches Festival: Klein, aber doch irgendwie groß; geplant und trotzdem improvisiert. Es ist so facettenreich, wie der Ort, an dem es stattfindet – die schöne Elbinsel, mitten in Hamburg gelegen. Hier finden sich neben dem obligatorischen Großstadtplattenbau auch idyllische Einfamilienhäuser, Bauernhöfe und viele Grünflächen mit grasenden Kühen.
Jene Kontraste werden schon auf der Fahrt zum Festivalgelände im Stadtteil Wilhelmsburg deutlich: Nur wenig Wohnhäuser werden passiert, dafür sieht man umso mehr von der ortsansässigen Industrie; zwischendurch grüßt immer eine Wiese, ein grüner Deich und das ein oder andere Windrad. In dieser ländlichen Umgebung fragt man sich unweigerlich: Ist das tatsächlich noch Hamburg? Doch genau inmitten dieser konträren Landschaft, auf einer brach liegenden Industriefläche direkt an der Norderelbe, findet das Dockville seit 2007 jährlich statt.
Keine Frage, dieses Festival hat Atmosphäre. Gemeint ist nicht unbedingt das unwegsame Gelände mit seinen Matschmassen oder etlichen Schlicklöchern, durch die der am besten mit Gummistiefeln ausgerüstete Besucher waten muss. Vorrangig ist es die umgebende Natur, der Blick auf den in der Ferne liegenden Containerhafen und der gigantische, fast bedrohlich wirkende Rethespeicher im Hintergrund des Geländes. Ein bisschen Ferropolis in der Hansestadt gewissermaßen.
Doch bevor der Spaß an diesem Freitag richtig losgehen kann, wird der geneigte Festivalist schon auf eine erste Geduldsprobe gestellt: Warten, denn der Einlass verschiebt sich um Stunden. Schnell wird noch versucht, das verschlammte Gelände durch Aufschütten von Kies aufzubereiten. Vor dem Eingang stauen sich in der Zwischenzeit die Besucher, sodass aus Sicherheitsgründen erst um 16 Uhr einzelne Gruppen nach und nach aufs Gelände dürfen. Für viele vergehen somit noch einmal rund anderthalb Stunden, bis auch sie endlich in den Genuss des Programms kommen dürfen. In Sachen Timetable herrscht zwangsläufig ebenfalls Chaos: Durch den verzögerten Start müssen Künstler, die eigentlich schon längst hätten spielen sollen, auf andere Bühnen verteilt werden. Hinzu kommt, dass einer der acht auf dem Gelände verteilten Auftrittsorte überhaupt nicht bespielbar ist. Weitere Acts fallen komplett aus. Wer kein Iphone besitzt, hat Probleme die ganzen Änderungen überhaupt zu verfolgen. Immerhin: Trotz schlechter Wetterprognose scheint schlussendlich doch noch die Sonne.

Lokalmusikalisch startet mit Eljot Quent das Programm schließlich um 16 Uhr auf dem Grossschot, der Hauptbühne des Dockville. Wortgewandter, unterhaltender HipHop der Hamburger Schule lockt sofort etliche Besucher an, die zu den teilweise elektronischen Beats von DJ Lutz Esselmann (alias Fogel, Red Zeppelin) tanzen. Lennard Kurtze (alias Len, Lenbert) und Johannes Müller-Wieland (alias Müwie, Johannes der Rapper) kommunizieren zwischen ihren Raps unentwegt mit dem Publikum. Passend zum Titel des letzten Songs verteilt das Trio im Anschluss gleich noch Aufkleber mit den Lettern „Bin derbe drauf“ – quasi als Mantra für das Festivalwochenende.
Nach vierzig Minuten Eljot Quent ist es Zeit für einen ersten Rundgang über das Gelände. Ziemlich schnell wird klar: Das Dockville will anders sein. Die Veranstalter verbinden hier Musik mit bildender Kunst und so trifft man abseits der Bühnen immer wieder auf große und kleine Kunstwerke, die frei zugänglich herumstehen. Dabei wird ein großes Holz-Ei genauso passiert wie etwa eine Art Kissenbaum, über den sich Frau Holle wohl sehr gefreut hätte. Eine Open-Air-Galerie mit Kunst für jedermann zum anfassen und hautnah miterleben. Wer Glück hat, findet sich plötzlich inmitten einer scheinbar spontanen Vorstellung von Performance-Künstlern wieder, auf den Minibühnen Horn und Nest werden Poetry Slams ausgetragen und Lesungen abgehalten. Entdecken und Partizipieren ist auf dem Dockville mindestens genauso wichtig wie das Thema Freiräume, die in Hamburg spätestens seit den Ereignissen im Gängeviertel lautstark diskutiert werden. Auch die Organisatoren des Hamburger Festivals kämpfen jedes Jahr um das Veranstaltungsgelände, für das sich mittlerweile ebenfalls Stadtplanung und Hafenwirtschaft interessieren. Noch ein Grund mehr für das Dockville, sich gewollt Independent und unkommerziell zu geben. Nach offiziellem Bandmerchandise sucht man hier beispielsweise vergeblich, stattdessen kann man in den Handelszonen Handgemachtes kleiner Labels erwerben: Shirts, Beutel, Schlüsselanhänger und weitere hübsche Accessoires.
Auf dem Vorschot spielt derweil eine niederländische Akustik-Popband mit dem Namen The Black Atlantic. Schnell dazugestellt und zugehört. Die sanften, gar zerbrechlichen Klänge von Gitarre, Drums, Ukulele und Co. gepaart mit dem schmerzlichen Gesang von Geert van der Velde laden zum Träumen im tiefen Matsch ein – und erinnern entfernt ein wenig an Coldplay, die an diesem Freitag in so gut wie jeder Umbaupause zu hören sind.

Zurück am Grossschot: Noch ist der größte Festivalplatz nicht komplett gefüllt. Die Norweger Casiokids sind gerade auf der Bühne und bringen die entspannten Dockviller mit ihrem simplen Synthie-Elekro-Pop einmal mehr zum ausgelassenen Tanzen. Hektik ist dem barrierefreien Festival fremd.
Um 18.30 Uhr heißt es dann: Bühne frei für die fünf hippen Schwedinnen von Those Dancing Days! Mit ihrem popigen Indiesound heizen sie dem mittlerweile gut gefüllten Platz vorm Grossschot ordentlich ein: Songs wie „Fuckarias“ oder „Those Dancing Days“ kommen besonders gut beim Hamburger Publikum an. Bei Cissi Efraimsson glänzen unterdessen nicht nur Kleid und Drums, sondern vor allem ihr schnelles und pumpendes Spiel am Schlagzeug. Die Frau hat Talent! Kollegin Lisa Pyk Wirström geht an der Hammond-Orgel ordentlich ab. Getoppt wird der Charme-Faktor der Schwedinnen allerdings von Gitarristin Rebecka Rolfart – Janis-Joplin-Lookalike – die jeden Zuspruch des Publikums mit einem süßen Lächeln quittiert und sich ehrlich über den Zuwuchs an Zuschauern seit dem letzten Auftritt 2008 freut. Alles in allem eine durchweg überzeugende Performance.
Überzeugen tut auch der nächste Act, wenn er vom Stil her auch anfänglich etwas befremdlich daherkommt: Dunkelbunt. Hinter diesem assoziativen Namen verbirgt sich der gebürtige Hamburger Ulf Lindemann, der sich auch für diesen Live-Auftritt wieder seine musikalische Unterstützung – The Secret Swing Society – auf die Bühne holt. Ihr Sound ist an diesem frühen Abend wohl der außergewöhnlichste auf dem Grossschot-Platz: Südosteuropäischer Folklore, Klezmer (jüdische Volksmusik) und Elektroswing – gewürzt mit Prisen von HipHop und Reggae, was den Gesang betrifft. Orient und Okzident werden vereint; Live-Instrumente, wie Klarinette, Trompete, Gitarre oder Drums mit Geräuschkonserve an den Turntables kombiniert. Wenn sie nicht gerade eines der Musikgeräte bedienen müssen, tänzeln die fünf Jungs auch schon mal über die Bühne oder Florian Tavernier animiert das Publikum zum Nachahmen seiner Mundakrobatik.
Es wird wieder rockig: Johnossi stehen als nächstes auf dem Grossschot. Kaum einer verlässt jetzt noch den Platz an der Hauptbühne. Als das dynamische, schwedische Duo 2007 zuletzt allein durch Deutschland tourte, waren viele ihrer Konzerte restlos ausverkauft. Ihr Auftritt an diesem Abend beweist einmal mehr, dass ihre Musik richtig gut ankommt: Vor der Bühne pogen die Leute was das Zeug hält, drängen nach vorne und wieder zurück. Und natürlich wird besonders laut beim Hit „Man must Dance“ mitgegrölt. Schon beeindruckend, wie es Gitarrist und Sänger John Engelbert und Drummer Oskar „Ossi“ Bonde zu zweit gelingt, einen dermaßen komplexen und fetzigen Rocksound live raus zu hauen – der dann auch noch unfreiwillige Unterstützung bekommt, als passend zum künstlichen Dunst auf der Bühne plötzlich laut ein Nebelhorn ertönt. Für einen kurzen Moment liegen aller Augen auf einem riesigen, direkt am Festivalgelände vorbeifahrenden Containerschiff. Dann gleiten sie wieder zur Bühne um rechtzeitig einmal mehr mitzuerleben, wie Engelbert auf die große Trommel des Schlagzeugs hüpft und dreckige Riffs spielt.

22.30 Uhr, Tom Smiths Cappie sitzt: Der mit Spannung erwartete Headliner Editors betritt die Bühne. Das Set beginnt mit dem eher ruhigen, aber zum Ende hin treibenden „Camera“ als Opener und gewinnt mit „Bones“ als zweiten Song schnell an Tempo. Alle Alben der Briten werden auf der Setlist gleichermaßen berücksichtigt. In der Mitte des Konzerts gibt es neues Material auf die Ohren: „Two Hearted Spider“ besticht durch Smiths imposanten Bariton-Gesang, der majestätisch über das Gelände hallt. Ein viel versprechender Ausblick auf das kommende Album der Indierocker, die mit dem 2009 erschienenen „In this Light and on this Evening“ elektronischer geworden sind. Eine weitere Überraschung ist auch die Akustikversion von „The Weight of the World“, die für kollektive Gänsehautstimmung an der Barriere sorgt. Eindrucksvoll beweisen Editors einmal mehr, dass sie eine ausgezeichnete Liveband sind. Nicht nur, weil sie technisch gut sind. Auch die Ausstrahlung der Jungs, die konzentriert und mit Spaß bei der Sache sind, zieht das Publikum in den Bann. Allen voran Frontmann Smith – der an diesem Freitag die Rückkehr seiner Mädchenschwarmlocken unter einer Cappie versteckt hält und damit ein bisschen wie ein gealterter, liebenswerter Schuljunge aussieht. Er lässt sich auf der Bühne komplett gehen, high von der eigenen Musik: Exzentrisches Rumgehoppse mit dem Mikrofonständer und leicht verrückte Gesichtsmimiken sind die Folge. Und natürlich ziehen die Dockviller bei diesem energetischen Auftritt noch einmal mit: Es wird – wie so oft an diesem Freitag – wieder getanzt, gehüpft und gedrängt was das Zeug hält.
Fotos vom Dockville 2011
[nggallery id=301]