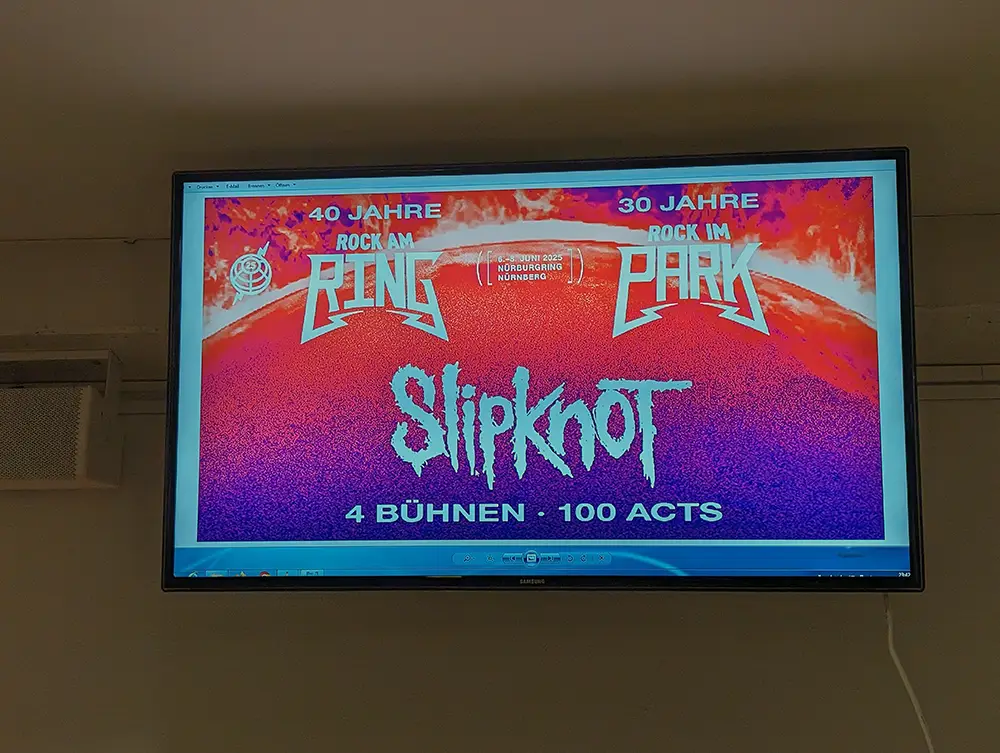Während Thomas sich mit Zelt und Kamera am See niederlies, pendelte Julia täglich zwischen Festival und der Diplomarbeit daheim. Ein Rückblick aufs Highfield – mit Rückblick.

Sehr häufig fällt ja nach drei Tagen auf einer unbequemen Luftmatratze, geschwächt durch diverse unerwünschte Blutergüsse aus der Moshpit oder schlicht katerbedingt das sehr profane Festival-Fazit: „Ich werd’ zu alt für diesen Sch**ß!“ Tatsächlich dreht sich auf dem Highfield dieses Jahr viel um Alter, zumindest für mich. Immerhin ist es mein Zehntes – da weiß man nicht so recht, ob man das Jubiläum gebührend feiern oder doch lieber melancholisch werden soll, wenn man sich der vergangenen 10 Jahre besinnt.
Damals, 2001 am Stausee Hohenfelden, Thüringen, war natürlich noch alles anders. Green Day standen im Lineup in Zeile 5 und spielten am frühern Nachmittag – heute undenkbar. Placebo, die damaligen Headliner, galten bis zur Wiederbelebung durch Mercedes Benz’ 125. Geburtstag vor ein paar Wochen quasi als tot. Doch nicht nur bei den Bands hat sich einiges getan. Auch organisatorisch legte das Highfield zu: „Höher, schneller, weiter“, oder besser „Größer, lauter, beliebter“, lautete die Devise. So beliebt, dass Agrargesellschaften sich gestört fühlten und man 2010 nach langen Diskussionen von einem See zum nächsten umziehen musste.
Eine neue Heimat fand man in Störmthal, Sachsen, inmitten der Leipziger Seenplatte. Der einst geografisch bezeichnende Name blieb aus Marketing-Gründen freilich erhalten. Vielleicht aber auch nur, weil Storm Valley Festival nicht ganz so sanft von den Lippen geht. Und nun sind wir hier, 2011, bei der zweiten Auflage am neuen Standort. Die Erwartungen sind hoch, das Lineup vielversprechend – also nichts wie los!
Der Freitag

Es beginnt mit Regen. Viel Regen. Vor dem der freundlicherweise von T-Mobile bereitgestellte SMS-Service fortweg zuverlässig warnt. Nicht, dass der gemeine Highfielder nicht früher schon ein wenig Wasser überlebt hätte. Wer 2007 bei den Kaiser Chiefs vor Ort war, weiß wovon ich spreche.
Doch es klart auf und spätestens zu Kakkmaddafakka strahlen Sonne und Publikum um die Wette. Die Norwegen haben hier so eine Art Heimvorteil, der bei den Lokalpatrioten sofort greift: Schon im Juni haben sie in Leipzig erfolgreich das Campusfest geheadlinet und seither den Ruf einer ausgezeichneten Partyband.

Weiter geht’s mit Blood Red Shoes, einer Band zum Liebgewinnen. Das Setup ist gewohnt minimalistisch, aber ähnlich wie The Subways – und dieser Vergleich kommt sowohl musikalisch als auch optisch nicht von ungefähr: ein drahtiges Mädel an den Saiten, ein blonder Wildfang hinter’m Schlagzeug – wissen sie zu begeistern und reihen auf der Main Stage Brett an Brett. Zu Gehen fällt entsprechend schwer, aber andernorts locken nun einmal die hochgelobten Mona.
Jene spielen ein wenig ungünstig platziert auf der Blue Stage, dem diesjährigen Hassobjekt aller Fotografen und Fangirls zugleich. Denn: Aus Graben und Reihe 1 ist die Sicht, sagen wir, suboptimal und verursacht bei längerem Aufenthalt gerne einen steifen Nacken. Hinzu kommt die Lärmemission aus Richtung Hauptbühne, die nur gefühlte 100 Schritte entfernt liegt. Im richtigen Winkel hört man auf dem linken Ohr die eine und auf dem rechten Ohr die andere Band – oder einfach nur weißes Rauschen. Eine Neuerung im Vergleich zu 2010 (damals noch ohne offene zweite Bühne), die an diesem Wochenende zu vielen Debatten anregt.

Andernorts gibt es später Donots zu essen und die Molly floggt. Die Menge feiert ausgelassen, die Pits werden immer größer. Fast so als hätte man kollektiv geahnt, dass bei Seeed später der Funke ausbleiben würde. Zugegeben, es war ihr erster großer Auftritt nach langer Pause, da darf man es etwas gelassener angehen. In gewohnt stylishen Anzügen und mit schwingenden Handtüchern liefern die Herren ein entspanntes Set aus bekannten Hits und groovigen Neuerungen. Dennoch wabert es ein wenig gelangweilt vor sich. Richtig in Fahrt kommt das Publikum überhaupt nur beim strategisch clever untergebrachten Solo-Material von Peter Fox. Ein Kollege fasst zusammen: „Normalerweise machen Seeed Reggae-Dancehall. Heute haben sie den Dancehall-Teil leider weglassen.“
Der Samstag

The Royal sind in der Stadt und die Zeichen stehen auf „Störm“. Zumindest wenn es nach den irren Schweden von Royal Republic geht, die sich dank eines exzellenten Debütalbums und exzessiven Tourens längst vom Geheimtipp zur Festival-Überband gemausert haben. Adam Grahn dirigiert das Publikum mit dem kleinen Finger wie man es sonst nur von Farin Urlaub kennt. Seine Band verkörpert indes die reine Freude am Spiel. Empfehlenswert ist gar kein Ausdruck.

Später am Tag spielen die ebenfalls Festival erprobten White Lies auf. Nun sind die Briten nicht gerade für ihre extravaganten Shows oder Animationseinlagen bekannt. Lautes Mitgrölen und koordinierte Tanzeinlagen sucht man hier in der Regel vergebens; Musik zum entspannten Genießen eben. Umso überraschter ist Sänger Harry McVeigh als während des Sets plötzlich Sprechchöre und Klatschorgien einsetzen. Zugegeben, es mag an der außergewöhnlich hohen Konzentration von 30 Seconds To Mars-Fans in den ersten Reihen liegen, die im Mitmachen Frontmann-bedingt Routine haben, doch es ist schön zu sehen, wie verwirrt und zugleich stolz die Band angesichts dieser Aufmerksamkeit ist.

Es folgen The National, Interpol und The Kooks – die ersten beiden sehr zur Freude des eher anspruchsvollen Hörers; letztere zur kreischenden Begeisterung des weiblichen Nachwuchspublikums. Wer allerdings denkt, die schrille Euphorie habe bei den Wuschelköpfen aus Brighton ihren Höhepunkt erreicht, hat die Rechnung ohne Tages-Headliner 30 Seconds To Mars gemacht, deren Auftritt genauso mitreißen wie polarisieren sollte.
Die aus Los Angeles stammende Alternative-Band um den charismatischen Sänger/Schauspieler/Regisseur/Universalworkaholic Jared Leto reist nicht ohne einen gewissen Ruf im Gepäck. Leto wird, wenn nicht gerade für sein Talent und Aussehen hoch gefeiert, als Diva beschrieben; die fortwährende Eigenpromotion um sein musikalischen Schaffen auf sozialer Netzwerken jeder Art mitunter nur als störend. Doch mit dem „Echelon“ (der offiziellen Bezeichnung für Fans der Band) steht hinter all seinem Tun eine loyale Familie, die zum Teil bereits 12 Stunden vor dem Auftritt Position bezieht, um die ersten Reihen zu sichern. Da stört es auch nicht mehr, wenn La Leto sich eine Viertelstunde Verspätung zum Richten des Beduinen-Kostüms gönnt.

Das Set an sich hält mit entsprechendem Vorwissen, was es verspricht. Bei einem Studio-Album das konzeptuell auf der Beteiligung der Fans durch Hintergrundchöre und rhythmisches Mitklatschen basiert, ist es nur logisch, dass dies alles auch live passiert. Ergänzt um die wiederholte Aufforderung zu springen, zu springen und noch mehr zu springen. Überhaupt hat man den Eindruck die Worte „Jump“ und „Fuck“ zählen zu Jareds liebsten. Nur schade, dass er für Motivationstiraden dieser Art häufig ganze Strophen der eigenen Songs auslässt. Die hartgesottenen Fans mag es freuen, auf das Laufpublikum wirkt es zuweilen etwas befremdlich. Mehr als nur einmal vernimmt man den viel zitierten Satz: „Halt’s Maul und spiel!“ Ein Auftritt also, der Raum für Diskussionen lässt.
Der Sonntag

Ausgeprägtes Bühnen-Hopping charakterisiert den Sonntag: Von gut gelaunten Deftones, über schon fast untypisch extrovertierte Jimmy Eat World bis hin zum einem spontanen Gastauftritt von Rise Againsts Tim McIlrath bei Hot Water Music gibt es so einiges auf die Ohren. Aber will man ganz ehrlich sein, warten eigentlich doch irgendwie alle nur auf Dave Grohl und Gefolgschaft.
Im Pressebereich heißt es wie üblich Resümieren. Bei einer etwas improvisierten Abschluss-PK stehen die Macher Rede und Antwort. Die üblichen Themen werden abgehandelt: Besucherzahlen, Anzahl der Verletzten – alles im grünen Bereich. Grundtenor: Man habe noch Wachstumspotenzial. Nichts Neues, wenn man bedenkt, dass die FKP seit Jahren sehr angestrengt versucht das Highfield zum 50.000er-Festival auszubauen. Doch der Weg dahin ist noch weit. Auch drängt sich die Frage auf, ob das am derzeitigen Standort überhaupt möglich ist. Die Antwort wird 2012 liefern. Für den Anfang gilt es zunächst noch einige Kinderkrankheiten am neuen Standort zu glätten. Bei der derzeitigen 25.000er-Größenordnung wäre beispielsweise mittlerweile eine Zugangskontrolle für den ersten Brecher sinnvoll.

Vor der Hauptbühne wird es derweil eng, richtig eng. Den Foo Fighters eilt im Vergleich zu manch anderem nämlich ein ausgezeichneter Ruf voraus. Nicht umsonst wurde Dave Grohl unlängst vom NME zum Godlike Genius gekürt. Bei einigen eingefleischten „alten“ Highfieldern hat er an diesem Abend trotzdem etwas gutzumachen: 2005 ließ sich die Band nämlich nur widerwillig und mit ausgedehnter Verspätung auf die Bühne bewegen – um dann 10 Minuten vor der Zeit sehr unzeremoniell wieder zu verschwinden. Aber wie Dave Grohl es diesen Sommer in Milton Keynes bei der großangelegten Rückkehr der Foo Fighters so treffend formulierte: „We used to suck, but now we’re pretty rad.“ Und „ziemlich krass“ sind sie dann auch. Alter Hit auf neuer Hit auf alter Hit und zu jedem einzelnen wird mitgesungen, gegrölt, getanzt, geschubst und ausgerastet. Verzückung allerorten über eine Band und einen Frontmann, die als das Duracell-Häschen unter den Großen dieser Generation bekannt sind, weil sie ohne Unterlass spielen. So wird auch die traditionelle Unterbrechung vor der Zugabe wegrationalisiert, dafür lieber ein Lied mehr rausgedroschen bis der Strom schließlich abgedreht wird. Wiedergutmachung mehr als gelungen.
Alle unsere Bilder vom Highfield-Wochenende
[album id=15 template=compact]