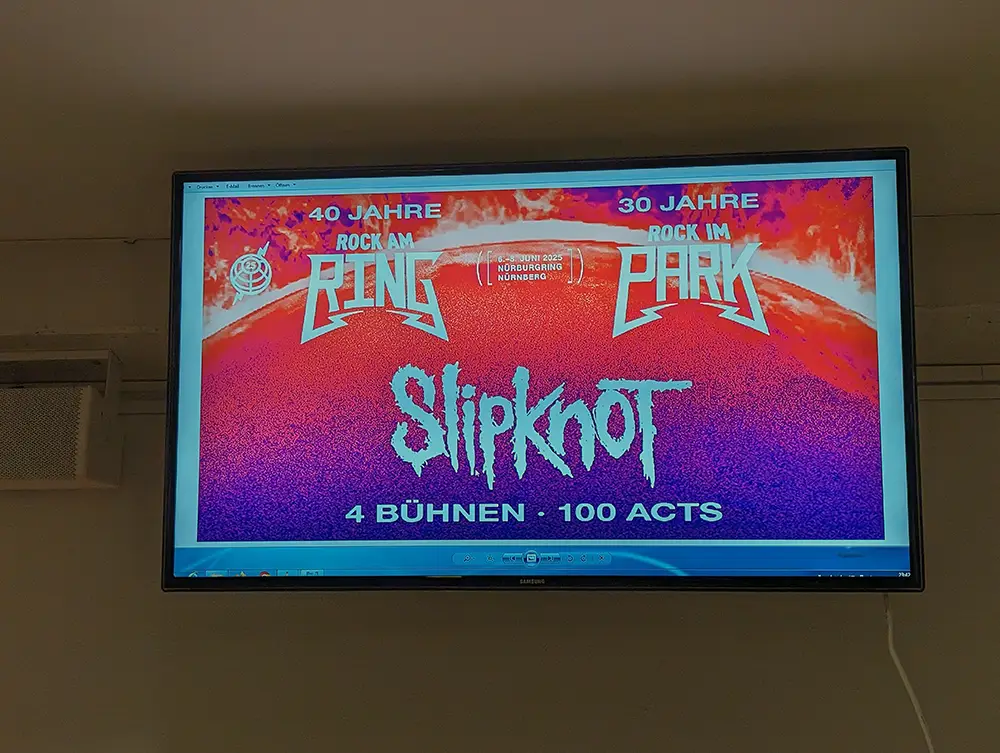![]() Southside 2011. Der Review. Teil 2: „Don’t throw cans at me, motherfucker!“
Southside 2011. Der Review. Teil 2: „Don’t throw cans at me, motherfucker!“
Musikprogramm am Freitag:
– Pete & The Pirates
– I Blame Coco
– Band of Horses
– The Wombats
– Arctic Monkeys
– Bright Eyes
Es kann manchmal sehr unangenehm sein, einen Ohrwurm zu haben. Gerade dann, wenn es um so etwas wie die Vengaboys (!) geht. Das nervtötende Gedudel im Kopf wird unterbrochen von einem Zugfahrgast, der sich von dem „Festivalpack“ gestört fühlt und uns schließlich den baldigen Drogentod wünscht. Nicht überall gibt es Verständnis von der Außenwelt. Dieser ganze Schlamm, der Regen – das kann man doch nicht mögen. Nur saufen. Oder ist es mehr? Obwohl es etliche Besucher gibt, denen der Spaß am Campingplatz die Investition des Ticketpreises wert ist, steht doch die Musik im Vordergrund. Ein grandioses Programm wurde auch in diesem Jahr von FKP Scorpio zusammengestellt, bestehend aus etwa 80 Bands. Auch wenn dabei einige ärgerliche Überschneidungen nicht ausbleiben, gibt es so genug Raum, musikalische Höhepunkte live mitzuerleben.
Das persönliche Konzertprogramm am Freitag beginnt, nach Kurzausflug zu Pete & the Pirates, bei I Blame Coco. Die junge Dame gibt ihr deutsches Festivaldebüt in der Red-Stage. Der Überschneidung zu Band of Horses wegen, bleibt nur Zeit für etwa zwei Lieder. Eines davon ist ihre Hit-Single „Self Machine“, von der jedoch wenig hängen bleibt. Der einsetzende Regen lässt massenweise Zuschauer in das Zelt strömen. Zusammen mit der Geräuschkulisse von den anderen Bühnen entsteht so ein Soundmatsch, der wenig zu tun hat mit dem ursprünglichen Lied. I Blame Coco gelingt es damit – unter erschwerten Bedingungen – in der kurzen Zeit nicht, zu begeistern. Und bleibt dabei weiterhin das, was sie nunmal in den Augen der Masse primär ist: Die Tochter Stings.
Raus zu Band of Horses. In den strömenden Regen. Am Ende The Funeral. Der Regen intensiviert hier die Atmosphäre um ein Vielfaches. Im Regen gestanden, The Funeral live gehört. Der erste magische Festivalmoment ist da.

Während der Umbaupause auf der Blue-Stage geht es jetzt das erste mal zur Green rüber. The Hives feiern – vor allem sich selber. Walk Idiot Walk wird durch das – mittlerweile bekannte – Einfrieren inmitten des Songs zelebriert. Am Ende bettelt Per Almqvist um Zugaberufe, wird schließlich zufriedengestellt und darf seinen letzten – ohnehin eingeplanten – Song runterspielen. Dann lieber zu The Wombats. Deren aktuelles Album „This Modern Glitch“ großartig ist. Auf Platte wie Live, auch dieses Mal. Das einzig störende ist der Matsch, der sich nach den ersten Stunden Dauerregen ungehindert auf dem Gelände ausbreitet. Das Programm geht aber weiter. The Wombats schließen – wie gehabt – mit „Let’s Dance to Joy Division“ ab und verschwinden nach großem Jubel hinter der Bühne.
Auf zu Arctic Monkeys, auch wenn der Regen ungebremst und mit konstanter Stärke auf die Besucher niederprasselt. Bereits auf dem Weg zur Green-Stage gibt es eine Überraschung: „Bet you Look Good on the Dancefloor“ wird erstaunlich früh gespielt und damit nur mit einem Ohr wahrgenommen. Insgesamt bleibt die große Begeisterung nach dem Konzert aus. Zu sehr stört Nässe und Kälte, sowie die Überschneidung zu den Wombats, die mich den Anfang des Konzerts verpassen ließ. Von Besuchern hörte man aber nach dem Konzert durchaus Positives: Etwa 2-3 Lieder vom neuen Album („Brick by Brick“ und „Don’t sit down cause i moved your chair“) und insgesamt eine ausgezeichnete Stimmung.
Nach Ende der Monkeys geht es zurück zum Zeltplatz. Die Regenjacken haben nach einigen Stunden ihre Funktion des Wasserabhaltens weitgehend aufgegeben und kleben am Körper. Frittenbude, und damit der erste Besuch in der vergrößerten White Stage, fallen damit flach.
Zurück geht es erst zu Conor Oberst und den Bright Eyes. Einem stark polarisierenden Auftritt, wie sich später zeigen sollte.
Im Zug hat die Diskussion über die besten Auftritte des Festivals begonnen. Der Name Bright Eyes fällt mehrfach – geteilt wird die Sichtweise nicht uneingeschränkt. Man habe sich „mehr ruhigeres“ gewünscht. Von dem „kleinen grünen Gartenzwerg“. In diesem Moment schaltet sich ein anderer Festivalbesucher ein: „Jetzt mal ganz vorsichtig hier.“
Dabei ist der Kommentar gar nicht so unpassend. Conor Oberst springt nach der Band auf die Bühne, tief eingehüllt in einen grünen Elfenmantel. Das erste Lied beginnt. In gebückter Position, aber stehend, haut er in die Tasten des Klaviers. Man assoziiert diesen Moment mit Quasimodo als Orgelspieler in Notre-Dame.
Ein Quasimodo, dessen Alkoholspiegel jenseits der 1-Komma gelegen haben muss. In der insgesamt impulsiven und energiegeladenen Show dreht er sich mehrfach samt Gitarre in Höchsttempo um die eigene Achse. 3-Mal am Stück und aufwärts. Das endet nicht nur einmal am Bühnenboden. Als eine Bierdose auf die Bühne fliegt, reagiert Conor Oberst wütend: „Don’t throw cans at me, motherfucker!“. Nach etwa einer Stunde endet das Spektakel. Ohne Zugabe, Ohne „First Day of my Life“. Die Zuschauer werden wütend, als auch nach einem langanhaltenden Jubeln keine Zugabe folgt. Beschwichtigend tritt ein Bandmitglied auf die Bühne: Wir würden gerne mehr spielen, können aber nicht. So fällt die Bewertung nicht uneingeschränkt positiv aus. Genial war es. Aber das ist es bei Conor Oberst immer.
Der Abend am Campingplatz endet vergleichsweise früh. In der Kälte. Ohne Partyzelt.
Teil1: Ein Hauch von Ibiza auf dem Campingplatz
Teil 2: Der Festivalfreitag – “Don’t throw cans at me, motherfucker!”
Teil 3: Der Festivalsamstag – Beth Gibbons umarmt ihre Fans
Teil 4: Der Festivalsonntag/Rückblick – Immer wieder. Warum auch immer.